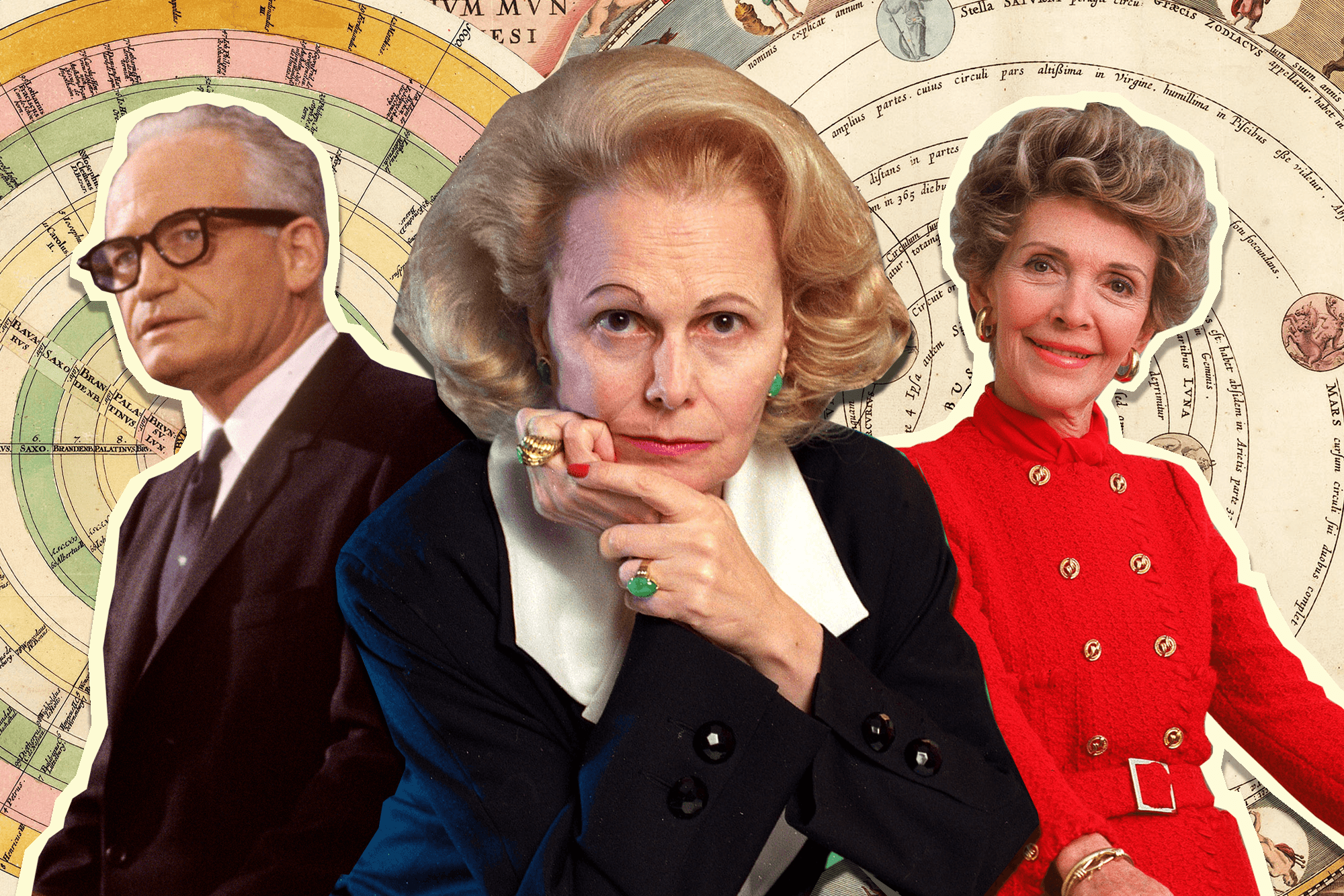ADHD-Stigma in BIPOC-Gemeinschaften: Über Rasse, Kultur und ADS

Als alleinerziehende Mutter zweier Söhne, bei denen ADHS diagnostiziert wurde, hatte ich vor zwei Jahrzehnten das Ziel, in Chicago eine Selbsthilfegruppe für Familien wie meine zu gründen. Als ich den Leiter einer benachbarten Selbsthilfegruppe in einem Vorort um Rat bat, riet sie mir davon ab und schlug vor, ich solle mich ihrer Gruppe anschließen, da ihrer Meinung nach die Kinder in den städtischen Gebieten nicht unter ADHS, sondern eher unter „Verhaltensproblemen“ litten. Mit anderen Worten: Schwarze Kinder galten einfach als ungezogen und litten nicht unter ADHS.
Ich wurde von anderen schwarzen Eltern kritisiert, weil ich meine Kinder mit Medikamenten behandelt habe, voller Ängste wegen der Nebenwirkungen oder sogar wegen ihres geheimen Ziels, die schwarze Gemeinschaft auszulöschen. Diese Eltern bestritten, dass ihre Kinder ebenfalls an ADHS leiden, und beschuldigten stattdessen die Schulen, ihre Kinder rassistisch anzugreifen. Meine eigene Mutter bestand darauf, dass strenge Disziplin alles sei, was meine Kinder brauchten, während eine Sozialarbeiterin erklärte, ich sei ein Wegbereiter bei der Beantragung einer Unterkunft für meinen Sohn.
Die schädlichen Auswirkungen von Stigmatisierung, Vorurteilen und fest verwurzelten Stereotypen auf den Umgang mit ADHS in unserer Familie waren erheblich. Dies ist keine einmalige Erfahrung – andere erleben diese schädlichen Vorfälle bis heute, obwohl sie vor über 20 Jahren stattgefunden haben. Die ADHS-Gemeinschaft hat schon lange mit einer solchen Stigmatisierung zu kämpfen, die besorgniserregenderweise sogar unter Fachleuten anhält, ganz zu schweigen von ihrer weit verbreiteten Verbreitung in marginalisierten Gemeinschaften wie der schwarzen Gemeinschaft.
Diese Unwissenheit, die sowohl innerhalb als auch außerhalb unserer Familien und Gemeinschaften herrscht, muss angegangen werden. Der ADHS-Autor und Fürsprecher René Brooks, der den Blog „Black Girl, Lost Keys“ leitet, behauptet, dass unsere Kinder dafür bestraft werden, dass sie neurodivergentes Verhalten zeigen. Sie betont, dass es unsere Aufgabe ist, Familien davon zu überzeugen, unterschiedliche Erziehungsansätze zu übernehmen, da es notwendig, wenn auch schwierig ist, unseren Kindern beizubringen, wie sie ihre Identität als Schwarze mit ADHS in Einklang bringen können.
Diese Stigmata prägen nicht nur die Erziehung innerhalb der schwarzen Gemeinschaft, sondern ziehen auch Kritik von außen auf sich, was laut Brooks die zusätzliche Herausforderung darstellt, den Erziehungsstil anzupassen, ohne von Weißen zu predigen oder mit dem Finger auf sie zu zeigen.
IngerShaye Colzie, eine ADHS-Coachin und Therapeutin aus der Nähe von Philadelphia, betont, dass Demütigungen durch Verwandte und Freunde besonders schädlich sein können. Sie stellt fest: „Wenn Ihr Freundeskreis nicht solide ist, werden Sie aufgrund Ihres Erziehungsstils und der Erwartungen anderer an Ihr Kind wahrscheinlich von Ihrer Gemeinschaft gemieden. Solche Missverständnisse können Sie aus Ihrem Freundeskreis ausschließen und Sie isoliert zurücklassen.“ Sowohl sie als auch Brooks erkennen an, dass dieses Stigma bei Menschen mit ADHS, die sich aus ihren Familienkreisen und kulturellen Gemeinschaften ausgeschlossen fühlen, zu Gefühlen der Einsamkeit und Marginalisierung beiträgt. Das allgegenwärtige kulturelle Stigma grenzt Schwarze, Indigene und Farbige (BIPOC) innerhalb der ADHS-Gemeinschaft weiter aus.
Kofi Obeng, der eine Online-ADHS-Selbsthilfegruppe für Afroamerikaner leitet, geht davon aus, dass diese Stigmata in einem übergreifenden System der weißen Vorherrschaft verwurzelt sind, das das Leben der Schwarzen abwertet und die Identität der Schwarzen dauerhaft bestraft. Er erklärt, dass diese Stigmatisierung oft dazu führt, dass die Schuld auf die Person mit ADHS geschoben wird, anstatt die wahre Ursache des Problems, ADHS selbst, zu erkennen. Obeng teilt seine eigenen Erfahrungen mit seiner Familie, die seine ADHS-Kämpfe auf einen persönlichen Mangel an Entschlossenheit zurückführt und sein Verhalten eher als persönliches Versagen denn als Symptome seiner Erkrankung interpretiert.
Dieses negative Stigma erzeugt Widerstand gegen die Diagnose und Behandlung von ADHS, da viele Eltern befürchten, dass eine ADHS-Diagnose eine geistige Behinderung bedeutet. Es besteht auch die Angst vor der Segregation in Sonderpädagogikprogrammen, in denen schwarze und lateinamerikanische Kinder überproportional vertreten sind, was häufig negative Folgen hat.
Romanza McAllister, eine erfahrene Trauma-Psychotherapeutin, ADHS-Trainerin und Erwachsene mit ADHS, offenbart eine weitere Befürchtung schwarzer Eltern – dass Diagnosen und die damit verbundene Behandlung zu Misshandlung und Bestrafung ihrer Kinder führen und sie möglicherweise in die Schule-in-Gefängnis-Pipeline drängen könnten.
Diese Befürchtungen werden durch eine Geschichte missbräuchlicher institutioneller medizinischer Praktiken verschärft, die zu Zögern und oft auch zur Ablehnung führt, Medikamente in ADHS-Behandlungspläne aufzunehmen – eine Entscheidung mit oft verheerenden Folgen.
Die in Chicago ansässige Kinder- und Erwachsenenpsychiaterin Angela Mahome, M.D., stellt fest, dass Eltern aus ihren Familien mit schwarzen Patienten im Allgemeinen dazu neigen, mit Abwehr und Wut zu reagieren, wenn sie ADHS-Medikamente empfiehlt. Sie findet, dass es oft einen Unterschied machen kann, über ihre eigenen Erfahrungen mit ADHS und den von ihr verwendeten Medikamenten zu berichten. „Während ich bemühe, nicht meine eigenen Erfahrungen in die Sitzungen einzubringen, ist es manchmal von Vorteil, wenn ich meine eigene ADHS und die Tatsache, dass ich Medikamente verwende, um damit umzugehen, offenlege. Dadurch sehen sie mich anders und die Eltern sind optimistisch, was die ihres Kindes angeht.“ Zukunft."
Diese Befürchtung ist nicht auf Kinder beschränkt. Laut McAllister tendiert die schwarze Gemeinschaft dazu, ADHS mit Faulheit und rebellischem Verhalten bei Kindern in Verbindung zu bringen. Diese Wahrnehmungen wirken sich auch auf die Erwachsenen aus. Studien zeigen, dass Afroamerikaner im Vergleich zu Weißen häufig inkonsistente Pflege erhalten und selten in entsprechende Untersuchungen einbezogen werden. Sie greifen eher auf Notaufnahmen oder die allgemeine Pflege zurück als auf Spezialisten für psychische Gesundheit. „Die Offenlegung einer Diagnose ist oft riskant. Wir haben häufig erlebt, dass unsere Bedürfnisse ignoriert und vernachlässigt werden.“
Farbige Menschen werden oft kritisiert oder verachtet, weil sie sich von ihren weißen Kollegen unterscheiden. Ihre Überzeugungen sind unterschiedlich. Sie funktionieren nicht auf die gleiche Weise und kommen auch nicht zu den gleichen Schlussfolgerungen. Daher wird ein schwarzer Elternteil, der zögert, seinem Kind Medikamente zu geben oder eine Diagnose zu akzeptieren, als weniger gebildet oder unbewusst wahrgenommen. Man geht davon aus, dass es ihnen an Verständnis dafür mangelt, was das Beste für ihr Kind ist. Diese Stereotypen sind zum Teil auf die eigenen vorgefassten Meinungen der Praktiker und unzureichende Kenntnisse der kulturellen Normen zurückzuführen.
„Wenn farbige Menschen sich schließlich dazu entschließen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen oder etwas offenzulegen, stoßen sie oft auf Zweifel“, beobachtet McAllister. „Eine große Anzahl von Menschen ist auf Praktizierende gestoßen, die sich weigern, etwas über die Traditionen und Überzeugungen anderer Kulturen zu lernen. Sie scheitern auch daran, sich mit ihren eigenen Vorurteilen und Vorurteilen auseinanderzusetzen.“
All dies führt dazu, dass farbige Menschen, sowohl Kinder als auch Erwachsene, nicht diagnostiziert, falsch diagnostiziert und unbehandelt bleiben. Dies führt tendenziell zu negativen Ergebnissen. McAllister weist darauf hin: „Das Leben mit nicht diagnostizierter ADHS und der Umgang mit Rassismus und Diskriminierung setzt einen einer Reihe gleichzeitig bestehender psychischer und physischer Gesundheitsprobleme aus. Nicht diagnostiziert oder falsch diagnostiziert zu werden, kann zu schnelleren und häufigeren Begegnungen mit dem Justizsystem und der Institutionalisierung führen.“ " Wer nicht diagnostiziert und nicht behandelt wird, hat häufiger mit Problemen zu Hause, in der Schule oder am Arbeitsplatz zu kämpfen und ist anfälliger für Mobbing, sowohl auf Spielplätzen als auch am Arbeitsplatz.
Obeng stimmt zu. „Einige ADHS-Betroffene entwickeln Minderwertigkeitsgefühle und führen ein einsames Leben. Diese Zustände sind ein fruchtbarer Boden für Depressionen, Sucht und Selbstverletzung. Ihre schädlichen Auswirkungen wirken sich auf mehrere Aspekte des Lebens einer Person aus und führen zu gesundheitlichen Problemen, Beziehungsproblemen, finanziellen Problemen, und arbeitsbedingte Schwierigkeiten", sagt er. „Die Pipeline von der Schule bis zum Gefängnis ist voller schwarzer Jugendlicher. Viele schwarze Familien kämpfen darum, sich Wohlstand zu sichern. Hohe Armut und ein Kampf ums Überleben sind an der Tagesordnung.“
Bei einem kürzlichen Treffen afroamerikanischer Führungskräfte und Befürworter der ADHS-Gemeinschaft wurde Stigmatisierung als das Hauptproblem hervorgehoben, mit dem farbige Menschen mit ADHS konfrontiert sind. Sie suchten nach Strategien, um dieses Problem anzugehen. McAllister wies darauf hin, dass es jungen Menschen helfen könnte, ihre Diagnose zu akzeptieren, wenn Erwachsene mit der Diagnose darüber berichten, wie die Behandlung ihr Leben verbessert hat. Dr. Mahome ist auch zuversichtlich, dass dies den Eltern Sicherheit geben könnte. „Wenn Menschen offen zugeben, an ADHS zu leiden, normalisiert sich die Erkrankung. Es kommt Eltern zugute, wenn erfolgreiche Menschen mit ADHS gut zurechtkommen.“ Deshalb spricht sie vielleicht über ihre eigene ADHS und die ihres Kindes, das an der University of Chicago studiert, während sie sich mit zögerlichen afroamerikanischen Eltern auseinandersetzt.
René Brooks hat dazu beigetragen, ADHS in der schwarzen Gemeinschaft, insbesondere bei Frauen, zu normalisieren. Brooks, ein Social-Media-Influencer, betreibt einen Blog und eine Website. Da immer mehr Menschen ihre persönlichen Erfahrungen teilen, werden die mit ADHS verbundenen Demütigungen und Stereotypen in allen Gemeinschaften abnehmen.
Der Schlüssel liegt darin, ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Wir brauchen Räume, um unsere Kämpfe zu teilen, unsere Siege zu feiern und gegenseitige Unterstützung anzubieten. Es gibt bereits etablierte Gemeinschaftsräume für farbige Menschen. ADDA ist Gastgeber einer virtuellen Peer-Selbsthilfegruppe für Afroamerikaner/Schwarze Diaspora + ADHS, die gemeinsam von McAllister und Obeng geleitet wird. Darüber hinaus haben Colzie, Brooks und andere Gelegenheitsplattformen wie Facebook-Kanäle und Blogs für schwarze Frauen mit ADHS entwickelt, um sich gegenseitig zu unterstützen.
Auch die Verbreitung relevanter Informationen auf Konferenzen sowie von Büchern und Artikeln wie diesem kann hilfreich sein. McAllister glaubt, dass „die Definition klarer ADHS-Vorkehrungen am Arbeitsplatz und die Bereitstellung einer stärker integrierten Schulung zu impliziter Voreingenommenheit, Antirassismus und Behindertenfeindlichkeit in Schulen und am Arbeitsplatz“ sich als nützlich erweisen könnte. Auch individuelle Anstrengungen sind erforderlich. Wir müssen uns wohl genug fühlen, um mit Freunden, Familie und Kollegen über ADHS zu sprechen.
Obeng glaubt, dass die Lösungen bei Einzelpersonen und Gemeinschaften als Ganzes liegen. „Auf persönlicher Ebene geht es um Selbstfürsorge und die Verbindung mit Gemeinschaften wie ADDA. Dort können Sie Freundschaften schließen und Ressourcen erhalten. Sobald man mit der richtigen Community verbunden ist, eröffnen sich Möglichkeiten – Selbsthilfegruppen, Coaches, Konferenzen.“
Es liegt nicht nur an uns, die Stigmatisierung in BIPOC-Gemeinschaften zu reduzieren. Wir brauchen mehr Ärzte, die so aussehen, sprechen und handeln wie die Patienten und Klienten, die sie sehen. Etablierte Organisationen halten Stereotypen aufrecht und pflegen Stigmatisierung. Sie müssen die Rolle erkennen, die sie spielen, und sie müssen bereit sein, sie zu korrigieren.
Die Beseitigung des ADHS-Stigmas in farbigen Gemeinschaften wird weder schnell noch einfach sein. Aber Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen sind bereit, sich den Herausforderungen zu stellen. Wir haben einen langen Weg vor uns. Wir werden Erfolg haben, wenn das ADHS-Stigma kein Kind oder Erwachsenen von der Diagnose und Behandlung abhält, die sie benötigen.
Evelyn Polk Green, M.S.Ed., ist eine ehemalige Präsidentin von ADDA und CHADD. Sie besitzt einen Bachelor- und einen Master-Abschluss der National Louis University sowie einen Master-Abschluss der Northern Illinois University.
1. Verwenden Sie eine klinische Sprache, die ADHS als Krankheit unterstreicht.
2. Vermeiden Sie Sprache, die verstörend sein oder als negativ empfunden werden kann:
1. Sprechen Sie über Medikamente nicht als Strafe oder Belohnung.
2. Machen Sie sich klar, warum Sie die Medikamente an schulfreien Tagen verabreichen oder nicht.
3. Beschämen Sie ein Kind nicht und lassen Sie es nicht zu, dass andere es beschämen, wenn es einen Therapeuten aufsucht oder Medikamente einnimmt.
1. Wenn Sie Bedenken mit den Eltern besprechen, konzentrieren Sie sich weiterhin auf den besprochenen Schüler.
2. Erkennen Sie die Fortschritte eines Schülers an.
— Angela Mahome, M.D.
Fordern Sie die Eltern auf und erlauben Sie ihnen, Fragen zu stellen. Patienten und ihre Familien haben möglicherweise Angst zu zeigen, dass sie die Diagnose nicht verstehen. Oder sie sind sich nicht sicher, was sie fragen sollen.
Stellen Sie immer sicher, dass Sie wissen, was Familien brauchen und welche Erwartungen sie haben. Manche Familien wollen keine Behandlung, sie wollen einfach nur wissen, was los ist. Bieten Sie Behandlungsmöglichkeiten an, aber lassen Sie sich Zeit für die Überlegung. Möglicherweise benötigen sie einen Folgetermin.
Es ist wichtig, Familien in die Diskussion einzubeziehen. Viele Familien betrachten die Behandlungsoption als eine Familienentscheidung. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Eltern und Kind im Raum Informationen an andere weitergeben. Im Medizinstudium wird uns beigebracht, dass der Patient und der Arzt alle Behandlungsentscheidungen treffen, aber viele Kulturen glauben, dass „es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen“. Beziehen Sie das Dorf mit ein, wenn dies der Wunsch der Familie und des Kindes ist.
Wenn Sie etwas nicht verstehen, was Sie über den Patienten wissen müssen, stellen Sie Fragen. Es ist keine Schwäche, es nicht zu wissen. Ihre Fragen zeigen Ihr Interesse.
Viele schwarze Eltern haben Angst vor dem medizinischen System und haben möglicherweise darauf gewartet, Hilfe zu holen. Verwechseln Sie eine solche Situation nicht mit Desinteresse.
Es ist wichtig, matriarchale Strukturen zu erkennen. Möglicherweise trifft die Großmutter oder ein anderer Ältester in der Familie die Entscheidung darüber, ob eine Behandlung durchgeführt werden soll. Bitten Sie die Entscheidungsträger, im Raum zu sein, um die Entscheidungsfindung zu informieren.
Unterschiede in Sprache und Kommunikation können ein Hindernis für die Pflege darstellen. Hören Sie der Familie und ihren Kommunikationsstilen zu.
Erkennen Sie Ihre eigenen Vorurteile gegenüber schwarzen Patienten an. Sie sind da und werden in Studien nachgewiesen. Verstehe sie und korrigiere sie. Wenn dies nicht geschieht, hat dies negative Folgen für den Patienten.
— Napoleon B. Higgins, JR, M.D.